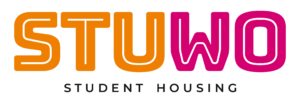Richtig zitieren für Studenten: Alle Infos zu Zitierstilen & Quellenangaben im Überblick
Verfasst von: Kerstin Lakits, 19.10.2023
Die erste Proseminararbeit oder Seminararbeit rollt auf dich zu. Vielleicht arbeitest du auch schon an deiner Bachelor- oder Masterarbeit. Egal, welche wissenschaftliche Arbeit du verfasst, das Zitieren ist überall ein essentieller Teil davon und ist das Kernstück des wissenschaftlichen Arbeitens. Korrektes Zitieren ist das A und O! Manchmal können die verschiedenen Richtlinien verwirrend sein, darum haben wir hier einen Leitfaden, der ein bisschen Licht ins Zitier-Dunkel bringen soll. So zitierst du immer richtig!
Inhaltsverzeichnis:
- Was ist ein Zitat und warum ist richtiges Zitieren so wichtig?
- Arten von Quellen: Bücher, Internetquellen & Co.
- Zitat-Typen: Über direkte und indirekte Zitate
- Die Arten von Verweisen: Wo steht das Zitat richtig?
- APA, Harvard & Co.: Die gängigsten Zitierweisen im Detail
- Übersicht: Die wichtigsten Abkürzungen
- Plagiat vermeiden: Was muss man beachten?
- STUWO Bonustipps